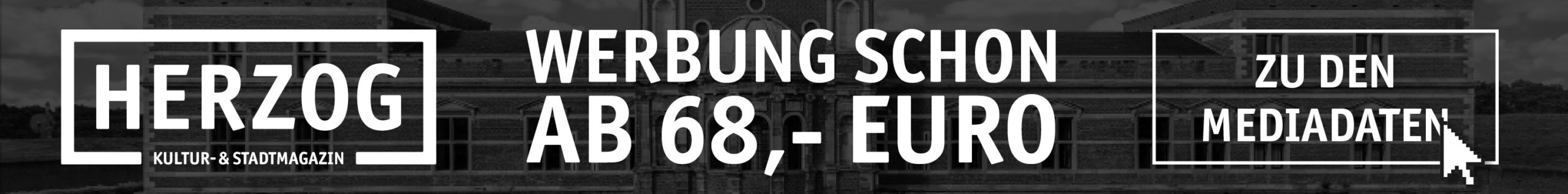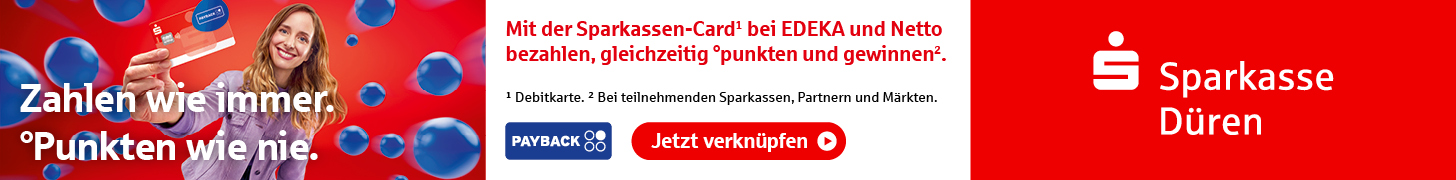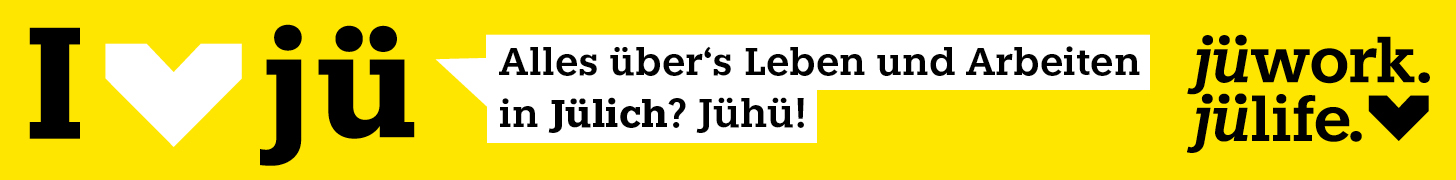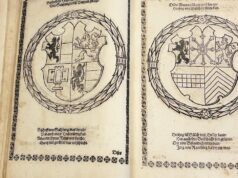Kondensstreifen am Himmel beeinflussen das Klima stärker als bisher angenommen. Forschende des Forschungszentrums Jülich und der Universitäten Mainz, Köln und Wuppertal haben herausgefunden, dass mehr als 80 Prozent der langlebigen Kondensstreifen in hohen Eiswolken, sogenannten Zirren, entstehen.
Bisher gingen Wissenschaftler davon aus, dass sich Kondensstreifen vor allem im wolkenfreien Himmel bilden. Bislang ist allerdings nur teilweise verstanden, wie sich Kondensstreifen auf das Klima auswirken. Die Forschung geht von einem überwiegend wärmenden Effekt aus. Forschende des Forschungszentrums Jülich sowie der Universitäten Mainz, Köln und Wuppertal zeigen nun: Mehr als 80 Prozent aller langlebigen Kondensstreifen bilden sich nicht im wolkenfreien Himmel, sondern innerhalb bereits bestehender natürlicher Eiswolken, so genannten Zirren. Welche Klimawirkung diese eingebetteten Kondensstreifen haben, ist bislang kaum erforscht. Bisher ging die Forschung davon aus, dass sich langlebige Kondensstreifen vor allem im wolkenfreien Himmel bilden und dort ihre wärmende Wirkung entfalten. Die neue Studie zeigt jedoch, dass sie in den meisten Fällen innerhalb bereits vorhandener natürlicher Eiswolken entstehen – eine Situation, deren genaue Klimawirkung bislang kaum erforscht ist.
Was die Forschung weiß: Diese aus Kondensstreifen entstandenen Zirren – so genannte Kondensstreifen-Zirren – wirken sich insgesamt stärker auf das Klima aus als die direkten CO2 – Emissionen des Luftverkehrs. Sie halten einen Teil der von der Erde abgestrahlten Wärme in der Atmosphäre zurück und tragen so zur Erwärmung bei.
Ob der Effekt tatsächlich wärmend oder in Einzelfällen leicht kühlend ist, hängt von den Umgebungsbedingungen ab. Bilden sich Kondensstreifen-Zirren im wolkenfreien Himmel oder in dünnen Eiswolken, verstärken sie meist den Treibhauseffekt: Das Sonnenlicht durchdringt die eher dünnen Eiswolken, wird von der Erde absorbiert und anschließend wird die Wärme von der Eiswolke wie ein Mantel eingeschlossen – die Atmosphäre erwärmt sich weiter. Treten sie dagegen in sehr dichten Wolken auf, sodass die Sonne kaum noch zu sehen ist, wird das Sonnenlicht von der Wolke reflektiert und erreicht die Erdoberfläche kaum – der kühlende Effekt überwiegt.
Professor Andreas Petzold vom Forschungszentrum Jülich erklärt dazu: „Wir müssen die Klimawirkung von Kondensstreifen differenzierter betrachten.“ „Fluggesellschaften könnten ihre Routen auch nach Eiswolkenstrukturen planen, um die Klimaeffekte zu verringern“, ergänzt Professorin Martina Krämer.
Die Forschenden nutzten Messdaten von Verkehrsflugzeugen der Europäischen Forschungsinfrastruktur IAGOS, die seit Jahren kontinuierlich Temperatur, Feuchtigkeit und weitere Atmosphärendaten sammeln. Die Ergebnisse fließen direkt in Klimastrategien der WMO, ICAO und EASA ein.
Zum vollständigen Beitrag.