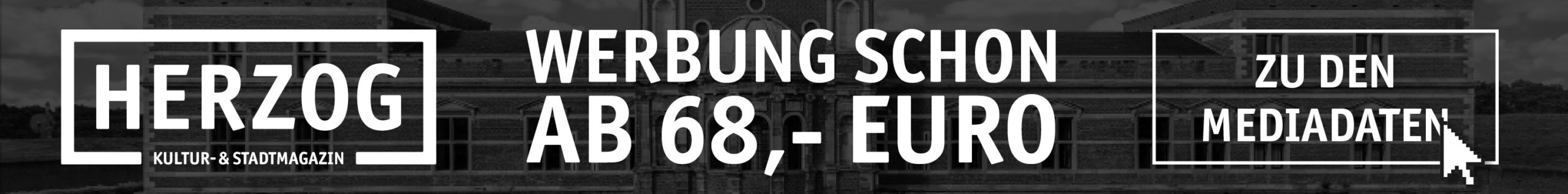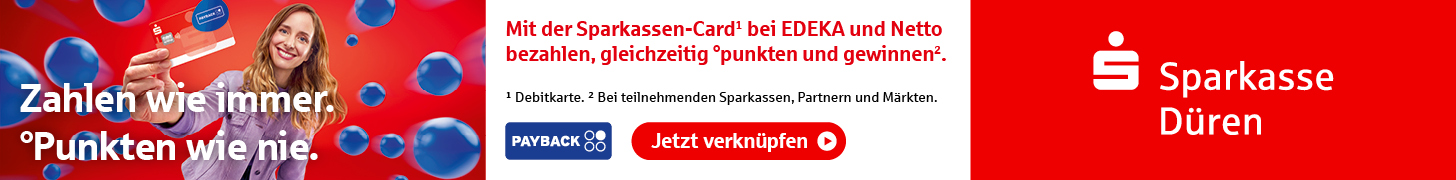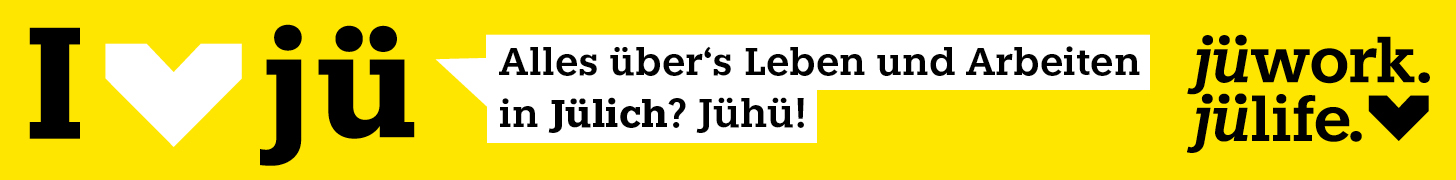Ein bisschen erinnert das Bild tatsächlich an die Vorbereitungen für eine Fahrt mit dem Fesselballon. Auf der grünen Wiese hinter dem Institut für Klima- und Energiesysteme, kurz ICE genannt, ist eine große blaue Plane ausgebreitet, es herrscht emsige Betriebsamkeit, eine gute Handvoll Menschen hantiert mit Gasflaschen und allerlei Zubehör. Immer mit am Start: Meterweise Schnur, Kabelbinder im Dutzend und mindestens eine dicke Rolle Klebeband. „Kabelbinder halten die Welt zusammen“, grinst Johannes Laube verschmitzt. Und er muss es wissen, ist der promovierte Chemiker doch gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Christian Rolf federführend in der gerade laufenden, sogenannten Ballonkampagne.
Laube und Kollege Rolf erforschen am FZJ unter anderem die Zusammensetzung von Gasen in der Stratosphäre und ihren Einfluss auf den Treibhauseffekt. Von Mai bis Oktober dauert die Monsunsaison und während der gesamten Zeit lassen die beiden Forscher und ihr Team kleine, mittlere und große Wetterballons aufsteigen. Bis zu vier Kilogramm „Reisegepäck“ darf so ein Ballon in die Lüfte tragen. Alles, was schwerer ist, wird nicht genehmigt. Hintergrund dieser Restriktion ist die Lage Jülichs in einem relativ dicht besiedelten Gebiet. Denn wenn die Schnur zerreißt, die Ballon und Sensorenpakete verbin-det, stürzen diese ab. Allerdings erfolgt der „Absturz“ kontrolliert, denn die Instrumente hängen an einem Fallschirm. Einem echten Raketenfallschirm übrigens, wie Laube hinzufügt.

Und hier kommt dann die Schnur ins Spiel: Nachdem die Sensoren sorgfältig in kleine Styroporkisten verpackt, mit reichlich Tape gesichert und – je nach Bedarf – noch mit einer Portion flüssigem Stickstoff tiefgekühlt wurden, werden die Behälter an den Fallschirm und dieser dann an den Ballon geknotet. Während Laube und seine freiwilligen Helfer sorgfältig knoten – frei nach dem Motto „Hauptsache, es hält“ – befüllt Markus Retzlaff den Ballon mit Helium. Damit hier nichts daneben geht, kommen die Kabelbinder zum Einsatz und sorgen dafür, dass die Öffnung des Latexballons den Einfüllstutzen fest umschließt. Das braucht seine Zeit und die nötige Geduld, ist aber der entspannte Teil des Ganzen. „Der Start ist der kleine Teil der Arbeit“, schmunzelt Laube, um dann zu erklären, dass jeder Flug hinterher zwei Tage Analyse im Labor bedeutet.

Zwei Ballons lassen die Forschenden an diesem Tag aufsteigen. Der kleinere der beiden sammelt unterschiedlichste Daten, zum Beispiel werden Ozongehalt und Wasserdampfkonzentration gemessen. Sein großer Bruder hingegen sammelt, vereinfacht ausgedrückt, Luft ein. Luft, die im Labor in eine kompliziert anmutende Apparatur umgefüllt und auf diverse Parameter untersucht wird. Dabei interessiert Johannes Laube unter anderem, wie hoch die Konzentration der vom Monsun transportieren ozonzerstörenden Substanzen und Treibhausgase ist, um Rückschlüsse darauf ziehen zu können, wie diese das Klima in Europa auf lange Sicht beeinflussen.
Wäre es nicht naheliegender und vor allem unkomplizierter, sich die benötigten Daten und ab und an eine Portion Luft von einem doch ohnehin fliegenden Flugzeug mitbringen zu lassen? Johannes Laube winkt lachend ab. Nicht hoch genug, so die simple Erklärung. Verkehrsflugzeuge werden durchaus in der Atmosphären- und Klimaforschung eingesetzt – von den Kollegen nebenan sogar. Wetterballons haben jedoch einen entscheidenden Vorteil: Sie erreichen deutlich höhere Höhen. Der Rekord lag bei 36 Kilometern Höhe, erinnert sich Institutsleiterin Professorin Michaela Hegglin. Üblich seien um die 30 Kilometer und damit könnten folglich andere Luftschichten untersucht werden.
Bevor ein Ballon überhaupt starten kann, braucht es die passende Wetterprognose. Gewitter, Starkregen oder heftiger Wind sind keine optimalen Voraussetzungen. Anhand der Wetterdaten berechnet das Team von Laube und Rolf, wo es den jeweiligen Ballon hintreiben wird und entscheiden dann, ob gestartet wird. Dieses Mal wird der Landeplatz voraussichtlich bei Bergheim liegen. „Wir sind aber auch schon nach Olpe oder nach Koblenz gefahren“, berichtet Markus Retzlaff. Mittels GPS-Sensor verfolgt das Team den Flug. Sobald der Ballon aufgrund des abnehmenden Luftdrucks seine maximale Aus-dehnung erreicht hat und schließlich platzt, kann bis auf einen Kilometer eingegrenzt werden, wo die Messinstrumente landen werden. Dann heißt es, ab ins Auto, alles einsammeln und wieder ins Labor bringen, wo dann zwei Tage lang auf Hochtouren gearbeitet wird. Bis zum nächsten Start.
Mehr über die Ballonkampagne.
Zur Internetseite des ICE-4 geht es hier.