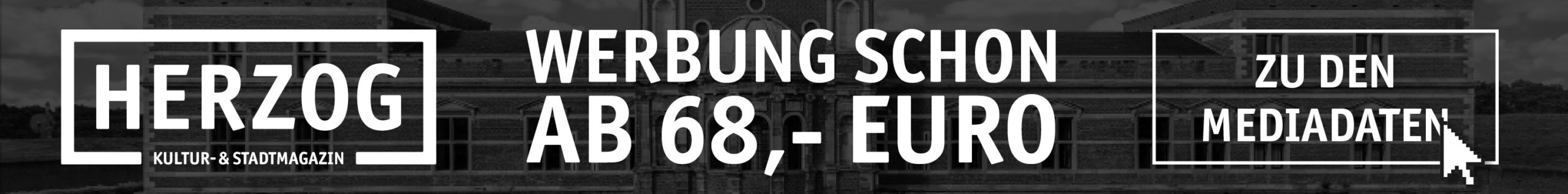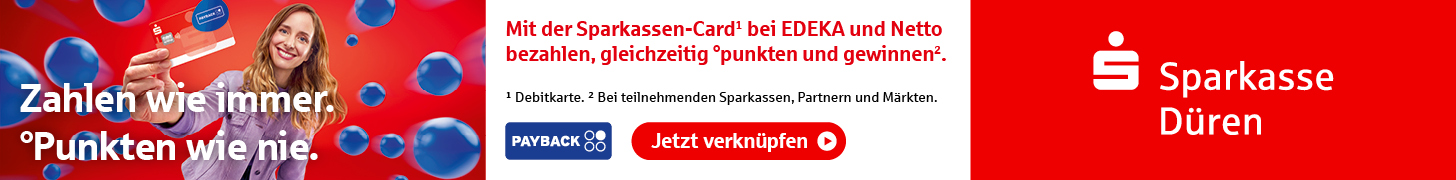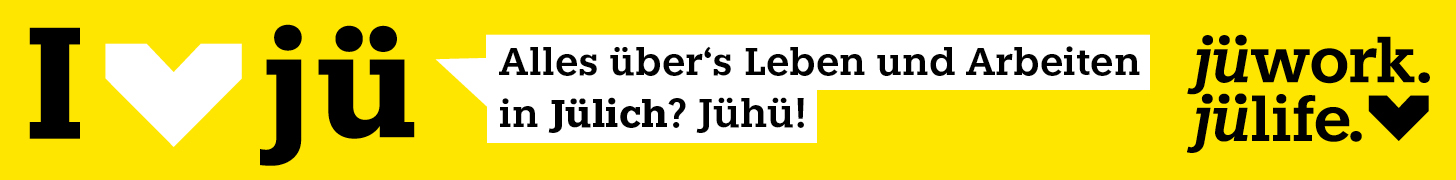Jedes Jahr sind sie automatisch wieder da und jedes Jahr könnte man die Frage stellen: Ist das eigentlich noch zeitgemäß? Maibräuche mit Frauenversteigerungen, Märschen im Gleichschritt und wilden Trinkgelagen?
Naja, ganz so einfach ist das nicht. Zumal sich die meisten üblen Klischees bei näherem Hinsehen doch ziemlich relativieren. Vielleicht hilft es ja, einmal aufzuklären, woher diese Bräuche eigentlich kommen und warum sie bis heute so zelebriert werden. Bei allen Details und Unterscheidungen von Ort zu Ort lassen sich da doch ein paar generelle Linien nachzeichnen.
Da ist erst einmal das sogenannte Mailehen, das Spiel, um das sich alles dreht. Die scherzhafte Bildung von provisorischen „Ehepaaren“ auf Zeit: Das kannte man früher schon im Adel, und von dieser Art von spielerischer „verkehrter Welt“ mag man sich in einigen rheinischen Dörfern auch etwas abgeschaut haben. Mag das eher noch eine vage Herleitung sein, so ist es doch zumindest sicher, dass in vielen Orten die Junggesellen schon lange Zeiten hindurch für die jährliche Ausrichtung von Tanzveranstaltungen verantwortlich gewesen waren. So auch im Jülicher Land. Dass es dort dann öfters mal wild herging, belegen Polizeiberichte und Gerichtsakten. Von da aus ist nur noch ein Schritt bis hin zu den ersten Vereinsgründungen. Nun gibt man sich Statuten und Regeln, eine Art Selbstregulierung, damit es die Obrigkeiten nicht tun.
Bliebe noch der Maibaum, oft verklärt als altes heidnisches Fruchtbarkeitssymbol oder keltischer Frühlingskult. Mitnichten, er ist wohl eher als ein weithin sichtbares Ehrenzeichen zu verstehen, das dem gesamten Dorf und den Feiernden gilt, ganz analog zu den gesteckten Maien, die man als Symbole der Ehrerbietung den Damen des Herzens ans Haus hängt. Älter als immerhin 500 Jahre sind solche Sitten allerdings nicht. Der Germane hat damit also wenig zu tun.
Das war die Frage nach dem Woher. Aber warum das Ganze? In früheren Jahrhunderten sicherlich, um überhaupt einmal unbewacht in die Nähe des anderen Geschlechts zu kommen. Vielleicht fungierte die Kirmes hier und da auch als eine Art dörflicher Heiratsmarkt. Heute aber wird das wohl kaum noch so sein. Vielmehr feiert man hier eines der Hauptfeste des Jahres, zu dem sich alle treffen. Als junges Maiclubmitglied möchte man dazugehören und Anerkennung finden, und um das zu schaffen, muss man sich ein bisschen anstrengen. Für die vier Wochen, in denen man seiner Maidame zugeteilt ist, gibt es schon ein paar mehr oder weniger strenge Regeln, wie das alles abzulaufen hat. Benimmt man sich richtig, darf man sich als verdientes Mitglied der Dorfgemeinschaft wähnen.
Auch wenn das eher nach Südsee klingt, ist so eine Kirmes in Wahrheit also eine Art von Initiationsritus. Im jungen Alter von zumeist gerade mal 16 Jahren übt man sich plötzlich in Verantwortung und sozialer Reife, organisiert eine große Veranstaltung und hantiert mit nicht unerheblichen Finanzmitteln herum. Betrunken sein ist das eine, das andere aber ist, dass ein so großes Fest niemals ohne eine gewisse Disziplin gelingen würde. Ausgelassen feiern und mit Vernunft handeln steckt also zu gleichen Teilen in einer Maikirmes.
So manch empfindlicher Geist entzündet sich natürlich noch an einer ganz anderen Sache, nämlich an der Rolle, die den Frauen zugeteilt bleibt. Ausgeführt werden und Schnittchen schmieren. Und natürlich an der Tatsache, dass man die Damen meistbietend versteigert. Zwei Anmerkungen seien auch dazu gemacht. Die Maidamen sind an den Vorbereitungen und dem Ablauf der Festtage mehr beteiligt als man denkt. Man weiß im Vorfeld bereits, welche Paare sich vermutlich bilden werden und welche Damen so eine Junggesellenkirmes auch wirklich umfänglich mit durchziehen. In der Öffentlichkeit gewinnen die Maidamen in den letzten Jahren immer mehr Raum, im Hintergrund haben sie schon immer die Fäden mitgezogen. Und versteigert werden sie auch nicht wirklich. Versteigert wird nur das Recht, sie an den Kirmestagen exklusiv zum Tanz ausführen zu dürfen.
Trotz militärisch anmutender Aufmärsche und einem manchmal anachronistisch anmutenden Umgang mit dem anderen Geschlecht würde ich eine vorsichtige Entwarnung geben. Die Jungs und Mädels sind größtenteils im 21. Jahrhundert angekommen.
Andreas Garitz hat außerdem die Redaktion besucht und über „Von Mai, klassischen Klischees und Geschichte“ mit Dorothée Schenk ein Gespräch geführt. Im Podcast zum Nachhören.