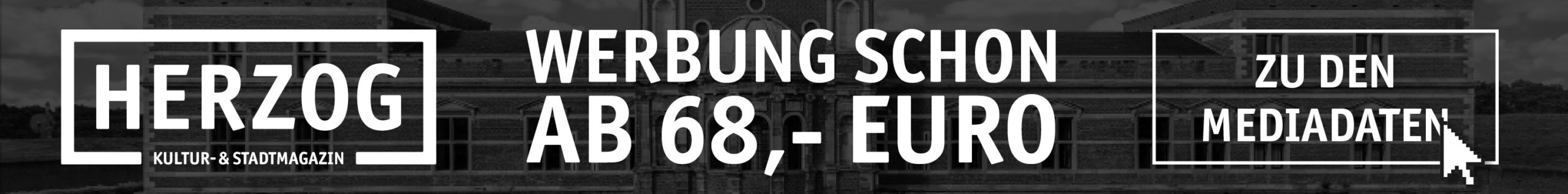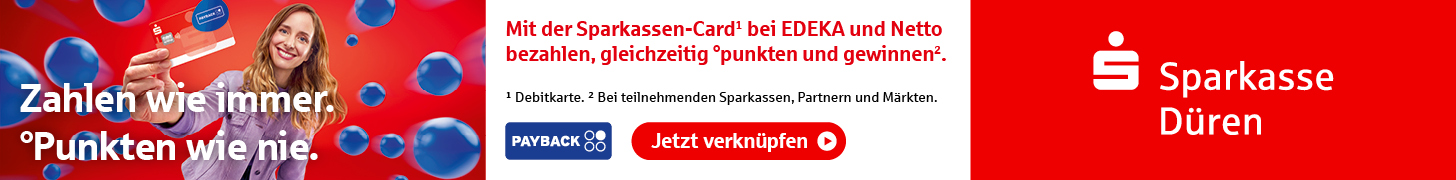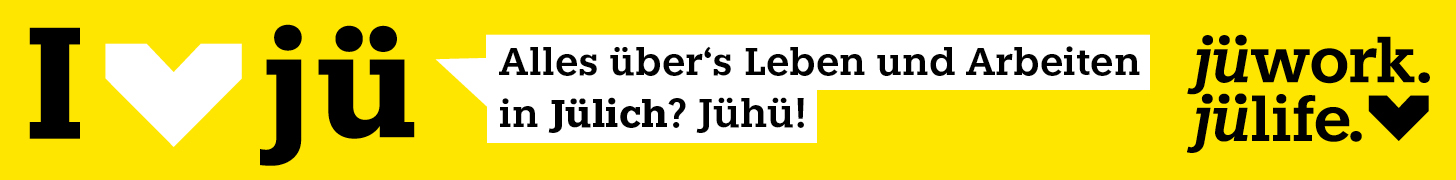Viel ist nicht zu sehen. Die Eisenbahnlinie endet an einem Prellbock, im Pappelwäldchen am Ortsrand von Siersdorf finden sich die Reste eines Schlagbaums. „Wir befinden uns hier auf dem Gelände des Zwangsarbeiterlagers der Zeche Emil Mayrisch“, erklärte Pfarrer Ralf Linnartz, der mit seiner Hand in den Wald deutete. Wer dort sucht, dürfte fündig werden: Betonsockel für die Baracken, Treppenstufen, eine sogenannte Splitterschutzzelle (Einmann-Bunker), die während des Zweiten Weltkriegs gegebenenfalls auch als Folterzelle benutzt wurde. Es gibt keine Info-Tafel, keinen Gedenkstein an die Menschen, die während der NS-Gewaltherrschaft hier gelitten haben, durch Arbeit und Hunger langsam ermordet wurden. Das ehemalige Zwangsarbeiterlager/Kriegsgefangenenlager in Siersdorf war nur eine von vielen Stationen der Fahrradwallfahrt zu Gedenkstätten der NS-Gewaltherrschaft im Nordkreis Düren, darunter auch die Villa Buth und Gut Linzenich, Wohnsitz des Jülicher Landrats Ulrich Freiherr von Mylius in der NS-Zeit.

„Nie wieder – dieses Versprechen klingt angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen oft abgenutzt“, hatte Ralf Linnartz die Teilnehmenden an der rund 35 Kilometer langen Tour am Bahnhof von Jülich begrüßt. „Aber das Versprechen gewinnt an Kraft zurück, wenn Namen genannt, Orte gezeigt, konkrete Geschichten erzählt werden. Das wollen wir heute tun“, verknüpfte er die Verankerung des Gedenkens im Hier und Jetzt mit der Frage: „Was tun wir heute?“ Gegen Gewalt, gegen Rechtspopulismus, gegen Ausgrenzung und gegen Unrecht. „Wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart.“ Diese Mahnung des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker begleitete die Teilnehmenden auf der Fahrt durch den Nordkreis. Unter der Überschrift „Gemeinsam erinnern. Für eine Zukunft in Frieden, Freiheit & Würde“ hatten der Katholikenrat der Region Düren in Kooperation mit dem DGB Kreisverband Düren-Jülich, der IGBCE Ortsgruppe Düren und dem Jülicher Geschichtsverein zu der Fahrrad-Wallfahrt eingeladen.
Das Lager am Rande der Zeche Emil Mayrisch wurde während des Krieges für sowjetische Kriegsgefangene errichtet (Arbeitskommando 15), die hier unter unmenschlichen Bedingungen als Arbeitssklaven missbraucht wurden. 1943/44 wurden auch italienische Kriegsgefangene dort interniert, die jedoch besser behandelt wurden als die russischen Soldaten. Bis zur Erweiterung gab es zunächst sieben Unterkunftsgebäude, drei kleinere Schuppen, einen Hundezwinger und die Lagerküche. Angaben zur Belegung schwanken zwischen 300 und 2400 Personen, in eine Baracke (6 mal 32 Meter) wurden jeweils 150 Menschen gepfercht. Ein vier Meter hoher Stacheldrahtzaun umgab das Areal. „Neben der militärischen Wachmannschaft kam eine ‚Rentner-Ersatztruppe‘ mit scharfen Hunden zum Einsatz“, berichtete Ralf Linnartz. „Es gibt Berichte von sadistischen Quälereien der Gefangenen.“ Nur wenige Lagerinsassen kamen tatsächlich bei den Abtäuf-Arbeiten des Steinkohlebergwerks zum Einsatz, das erst 1952 nach dem Krieg in Betrieb genommen wurde. Die meisten Kriegsgefangenen kamen in den benachbarten Bergwerken „Anna“ und „Maria“ zum Einsatz, einige Internierte wurden zur Feldarbeit herangezogen. Die Kombination aus starker Unterernährung und hoher Arbeitsanforderung forderte – von den Nationalsozialisten so eingeplant – viele Opfer. Die Toten wurden zum Teil auf dem nicht belegten Teil des jüdischen Friedhofs in Langweiler begraben. „Nach dem Krieg wurde auf dem Gelände ein Ledigenheim und ein Bergmannsheim der Zeche errichtet“, berichtete Linnartz.

Anhand des Schicksals der Familie Marcus Abraham, von der nur zwei Kinder die NS-Gewaltherrschaft überlebt habe, schilderte Ralf Linnartz in Aldenhoven das Schicksal vieler jüdischer Bürger, denen in der NS-Zeit nicht die Flucht gelang. „Dem Rassenwahn der Nationalsozialisten fielen 44 Personen aus Aldenhoven und den zum Kernort gehörenden Ortschaften zum Opfer“, sagte Linnartz. 1941 war jegliches jüdisches Leben in Aldenhoven erloschen, dessen Wurzeln vermutlich ins späte 13. Jahrhundert zurückreichen. Das 2009 eingeweihte Gedenkmonument steht in Sichtweite der ehemaligen Fabrik von Moritz Salomon, dem jüdischen Bethaus an der Alten Turmstraße und dem israelischen Friedhof an der Gerberstraße. Zwei Familienmitglieder waren zeitweise in der „Villa Buth“, die ebenfalls Station der Radwallfahrt war, interniert. Dort wurden auf Verfügung des Landrates in Jülich vom 15. März 1941 sämtliche Juden, die noch im Kreis Jülich wohnten, auf engstem Raum interniert. Sie mussten die eigenen Wohnungen räumen und in das sogenannte „Judenhaus“ ziehen. Ein Vorgang, der sich überall wiederholte und der die Überwachung und nachfolgende Deportation erleichtern sollte. „Heute, 80 Jahre nach Kriegsende, müssen wir uns mehr denn je gegen Geschichtsvergessenheit wehren, damit dies nie wieder geschieht“, betonte Ulrich Titz, Vorsitzender des DGB Kreisverbands Düren-Jülich.
„Nach einer Fahrradwallfahrt im Südkreis und einer im Nordkreis gibt es noch sehr viele Gedenkstätten und Orte, die wir noch nicht berücksichtigt haben. Wir werden sicherlich noch weitere Veranstaltungen organisieren“, kündigte Ralf Linnartz an, weiter gegen das Vergessen aktiv erinnernd unterwegs zu sein.