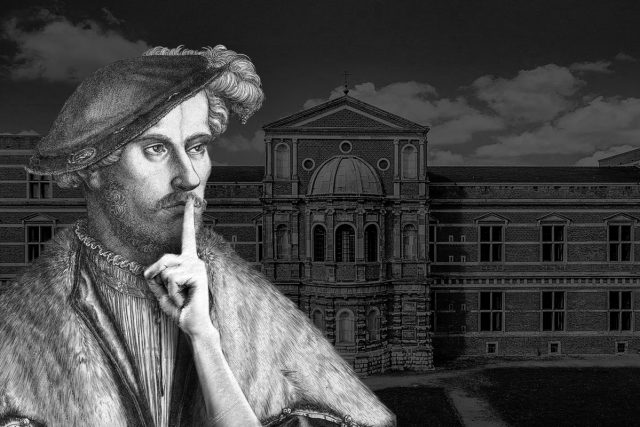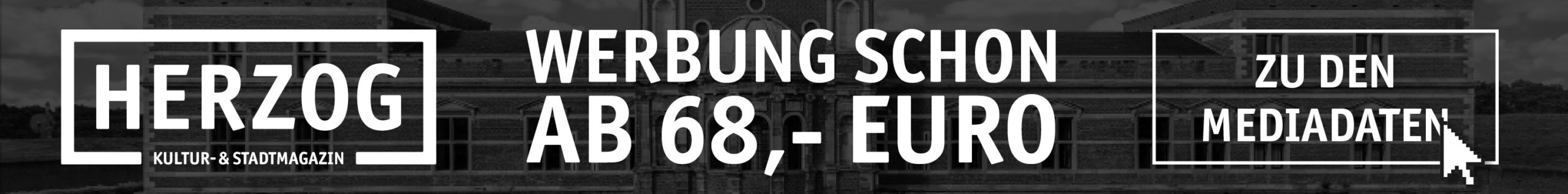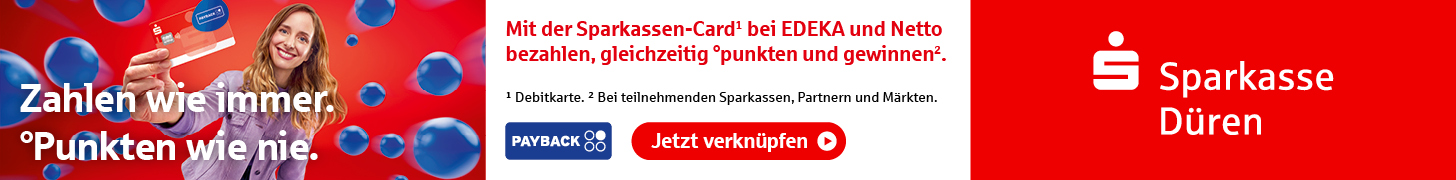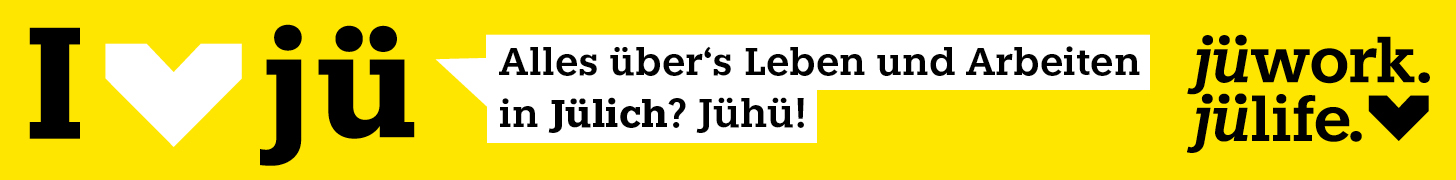Die Schwan GmbH ist insolvent. Wenn Unternehmen nicht mehr zahlungsfähig sind, ist das tragisch. Es betrifft die Gesellschafter ebenso wie die Mitarbeiter – und im Fall des Schwans auch die Gäste. Tatsächlich bleibt zunächst „alles wie es ist“. Die Gastronomie am Schwanenteich wie auch das Café auf dem Markt bleiben geöffnet.
Unerträglich ist, dass das Insolvenzverfahren und die davon Betroffenen unmittelbar nach Bekanntwerden durch die Sozialen Netze getrieben wurde. Die Kommentare übertrafen und übertreffen sich an Häme und Besserwisserei. Ganz im Gegensatz zu den Gästen, die – die Autorin war mehrfach Ohrenzeugin – anteilnehmend und unterstützend reagieren. Meist beziehen sich die negativen Bemerkungen auf die aufgerufenen Speisen- und Getränke-Preise. Wer regelmäßiger Gast im Schwan ist, weiß, dass dies offenbar nicht abschreckt. Zu gut besucht ist der Schwan zu allen Zeiten. Schnell ausgebucht waren die angebotenen Events. Max Lenzenhuber spricht von monatlich 4000 Gästen. Eine stattliche Zahl. Am Angebot liegt es also offensichtlich nicht. Sich aber mit den Hintergründen zu beschäftigen ist offenbar zu mühsam und bedient auch nicht die brodelnde Volksseele, die sich so gerne empört.
Seit 2016 sind der „Schwan“ und die Pläne von Max Lenzenhuber in der Diskussion. Zuerst wurde von Nostalgikern die jahrzehntelang verwaiste Trinkhalle betrauert, anschließend der Baukörper kritisiert – zu dem man zu Recht unterschiedlicher Meinung sein kann – und dann infrage gestellt, ob Jülich überhaupt eine Gastronomie wie den Schwan braucht. Der Schwan ist ein zusätzliches gastronomisches Angebot. Seinetwegen schließt keine im Sinne der Kritiker gesehene bezahlbare Gastronomie. „Futterneid“ wäre hier also völlig unangebracht, es ist genug für alle da.
Die Antwort, ob Jülich „einen Schwan“ braucht ist ein schlichtes „ja“. Die Kritiker sollten sich gegebenenfalls mit der (schon durch den Brainergy Park) wachsenden Zahl an Unternehmensspitzen auseinandersetzen, die für Geschäftsessen in Jülich wenig Alternativen sehen und ansonsten in die Region „abwandern“. Das ist keine Annahme, sondern durch Gespräche bestätigt.
Neben diesem Aspekt gibt es noch einen weiteren: Was treibt Menschen an, Menschen zu kritisieren, die ein unternehmerisches Risiko wagen und Arbeitsplätze schaffen? Vor allem dann, wenn sie nicht dem Staat, der Allgemeinheit oder Fremden dabei „in die Tasche“, sukzessive den Geldbeutel greifen. Die Kultur des Scheiterns ist in Deutschland nicht anerkannt. Das ist ausgesprochen bedauerlich. Denn es kann nur dem, der etwas versucht, etwas misslingen. Um Erich Ellinger, den deutschen Pädagogen, Dichter und Autoren zu zitieren: „Wer viel tut, macht viele Fehler. Wer wenig tut, macht wenig Fehler. Wer nichts tut, macht den größten Fehler.“ Vielleicht sollten wir eher Menschen zum Unternehmertum ermutigen, statt beim Scheitern auch noch verbal nachzutreten. Das ist schlicht beschämend. Wir brauchen Mut, Aufbruchstimmung und Menschen mit Engagement.
Lesen Sie hierzu Unsanfte Landung im Insolvenzverfahren